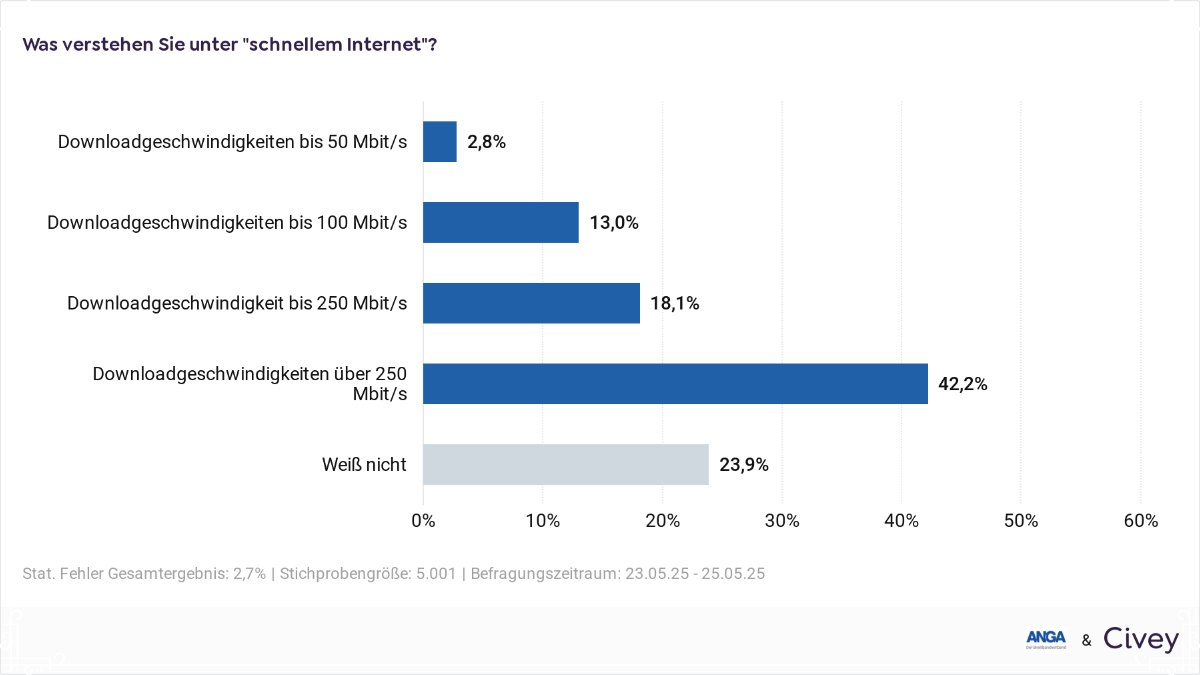Warum scheitern in Deutschland bereits viele notwendige Reformen im Ansatz und welche Gelingensbedingungen sorgen für moderne Staatlichkeit? Diesen Fragen widmet sich die „Initiative für einen handlungsfähigen Staat”. Im Sommer 2024 gründete die Medienmanagerin und Aufsichtsrätin Julia Jäkel gemeinsam mit den ehemaligen Bundesministern Thomas de Maizière und Peer Steinbrück sowie dem Juristen und ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Prof. Andreas Voßkuhle die Initiative, die unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier steht. Im März 2025 veröffentlichten die Autoren, die von über 50 Expertinnen und Experten unterstützt wurden, einen Zwischenbericht mit 30 konkreten Empfehlungen, wie staatliches Handeln in vielen Bereichen besser gelingen kann.
Warum haben Sie diese Initiative ins Leben gerufen?
Überall stoße ich auf ein Unwohlsein im Umgang mit Veränderungen in diesem Land. 70% der Bürgerinnen und Bürger halten den Staat laut Umfragen für überfordert. Es mangelt nicht an Reformideen, und es gibt viel: Man müsste, man könnte, man sollte. Aber wir schaffen es nicht, diese umzusetzen. Das spürt und fühlt in unserem Land jeder, es schmerzt fast.
Blicken wir auf den Bereich Digitalisierung. Was muss sich ändern?
Digitalisierung ist die Grundlage für alles, für Bürgernähe, eine schlanke Bürokratie und wirtschaftliche Dynamik. Nach der Reform des Onlinezugangsgesetzes sollte die öffentliche Hand alle digitalisierbaren Verwaltungsleistungen bis 2022 online anbieten können. Tatsächlich sind aber nur ein Bruchteil in den letzten Jahren digitalisiert worden. Da stellt sich doch die Frage, warum kriegen wir das nicht hin? Am Geld mangelt es gar nicht so sehr.
Wenn Sie sich dafür den sogenannten Maschinenraum des Staates ansehen: Was ist die Ursache dafür?
Es geht um Strukturen, die über Dekaden nicht reformiert worden sind – obwohl sich die Umwelt rasant verändert hat. Nehmen wir die Digitalisierung, die transformatorische Technologie KI oder aber auch die Sicherheitslage auf der Welt. Was tun? Hier gibt es zwei Wege, damit umzugehen. Entweder wir finden uns damit ab, oder wir versuchen, den Dingen auf den Grund zu gehen und anzupacken. Und es wird schnell klar: Im Digitalen mangelte es bisher an Verantwortung und Priorisierung. Es gab bisher einfach zu viele unklare Zuständigkeiten.
Wie kann man diese Krusten aufbrechen?
Zunächst müssen wir verstehen, dass die Dinge ineinandergreifen. Auf Bundesebene braucht es diese Priorisierung. Es braucht eine Verankerung im Kabinett, ein Ministerium mit Kompetenzen, mit Durchgriff, was den Tech-Stack und die Governance angeht und so die digitalen Aktivitäten der anderen Fachressorts mit lenken kann, so dass die Dinge effizient zusammenpassen. Und, ganz wichtig, es braucht ein neu zu klärendes Miteinander mit den Ländern. Wir können nicht die Kommunen allein lassen, etwa solche Serviceangebote, die hochautomatisierbar und skalierbar sind und keine Ermessensentscheidungen vor Ort bedürfen, allein digital umsetzen zu müssen. So landen wir bei dem aktuellen digitalen Flickenteppich, das ist einfach aus der Zeit gefallen. Die Kommunen brauchen doch alle ihre Kraft, nah an den Bürgerinnen und Bürgern zu sein, vor Ort zu wirken und erlebbar zu sein, und schlicht zu helfen. Das haben übrigens die Städte in den sogenannten Dresdner Forderungen schon lange gefordert.
Welche Hoffnung setzen Sie in das neue Digitalministerium und in Karsten Wildberger?
Viel. Das Ministerium ist gut ausgestattet. Und sehr erfreulich ist, dass unser Vorschlag, nicht auf ein Digitalministerium zu setzen, sondern eines für Digitales und Staatsmodernisierung zu schaffen, gehört wurde. Damit ist erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik „Staatsmodernisierung“ bzw. „Verwaltungsreform“ im Ministerien-Tableau institutionell verortet. Das ist wichtig, denn ohne modernisierte Strukturen, ohne ein angepasstes Dienstrecht des Öffentlichen Dienstes, das auch für Profis aus der Tech-Welt, etwa Data Scientists, attraktiv sein kann, wird diese gewaltige Transformation nicht gelingen. Ich finde es auch sehr erfreulich, dass mit Karsten Wildberger jemand an die Spitze des Ministeriums berufen wurde, der ein erfahrener Manager ist. Mit „Manager“ meine ich jemanden, der weiß, dass schon die dollsten Dinge auf Powerpoints standen, sie aber nie das Licht der Welt erblickten – weil es an der Umsetzung scheiterte. Solche Prozesse erfordern Zähigkeit, Analysetiefe, aber genauso moderne Leadership und ein Wissen darum, wie ich komplexe Organisationen in Schwingung bringe.
Welche maßgeblichen Herausforderungen kommen auf das Ministerium zu?
Kurz gesagt: Ins Handeln kommen. Das Ministerium wird sich jetzt rasant ein gutes Team aufbauen müssen, aber auch in ein gutes Miteinander mit den anderen Ministerien kommen müssen. Das Ministerium braucht das unbedingte Backing des Kanzlers und des Kanzleramtsministers. Das scheint mir zum Glück gegeben. Dann wird das Ministerium erste Erfolge benötigen – vielleicht kann das die digitale Wallet sein – aber es wird auch Erwartungsmanagement betreiben müssen. Viele dieser Prozesse sind so komplex, sodass überzeugende Lösungen schon eine Zeit brauchen. Es geht ja nicht darum, Altes oberflächlich zu digitalisieren, sondern wir müssen an die Wurzel von Prozessen und Strukturen heran. Eine zentrale Herausforderung ist die Interoperabilität der IT-Systeme in der öffentlichen Verwaltung. Unterschiedliche Standards und veraltete Systeme behindern effiziente Prozesse und Datenaustausch. Daten müssen als strategische Ressource genutzt werden – für bessere Entscheidungen, effizientere Prozesse und moderne Dienstleistungen. Dazu müssen wir die Auslegung des aus gutem Grund garantierten Datenschutzes lockern und praktikabler machen – etwa müssen wir risiko-arme von risiko-reicher Datenverarbeitung differenzieren, Forschungsanwendungen privilegieren etc. Aber es gehört auch der Aufbau souveräner Cloud-Infrastrukturen und sicherer Datenplattformen dazu.
Was passiert, wenn diese Voraussetzungen nicht geschaffen werden?
Wir sind wirklich ehrlich positiv überrascht davon, wieviel der Vorschläge unserer Initiative im Koalitionsvertrag abgebildet sind. Das finde ich erstmal ein sehr gutes Zeichen. Mein Eindruck ist, dass sehr viele Verantwortliche wissen, dass es drängt und ihnen der Ernst der Lage klar ist. Es gibt nun mal einen direkten Zusammenhang zwischen Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des Staates und Vertrauen in die Demokratie. Aber wir haben als Land schon so einiges geschafft nach dem Zweiten Weltkrieg, die Wiedervereinigung, die Agenda 2010… Ich bin guter Dinge, dass wir nun jeder auf seine Weise jetzt dazu beitragen kann und wird, unser Land nach vorn zu bringen. Wir sind ja der Staat, nicht irgendjemand „da oben.“